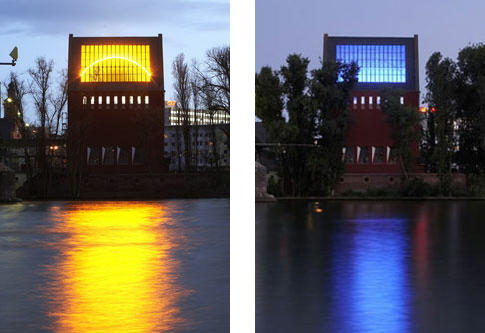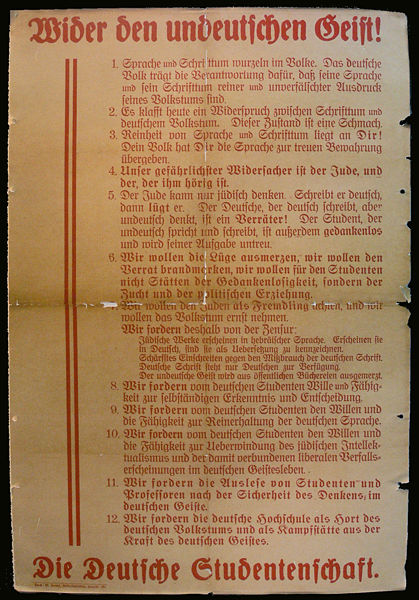Von Erhard Metz
Wenn der Botschafter der Französischen Republik von Berlin anreist, um im Frankfurter Museum für Moderne Kunst eine Ansprache zur Eröffnung einer Ausstellung zu halten, wenn sich der französische Generalkonsul die Ehre gibt, diesem Ereignis beizuwohnen und ebenso der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, dann muss im Hause des scheidenden Direktors Udo Kittelmann etwas Gewichtiges passieren. Und so geschieht es auch: Das MMK präsentiert eine umfangreiche Rückschau auf den im internationalen Kunstbetrieb noch immer weitgehend verfemten Bernard Buffet.
Dieses Unterfangen schlug in der Fachwelt gehörig Wellen. Inzwischen ist es ruhiger geworden, in den Feuilletons und Kulturmagazinen haben sich die dazu Berufenen an der Präsentation im MMK abgearbeitet, man hinterliess sein – in der Summe gesehen eher negatives – Urteil und ging zur journalistischen Tagesordnung über. Dabei hat die Präsentation im MMK eines sicher nicht verdient: Ruhe.
„Bernard Buffet – Maler“ heisst die Ausstellung. Obschon sie nicht die seinerzeitigen ebenso fragwürdigen wie geschäftstüchtigen Umtriebe Buffets verschweigt, setzt sie doch einen klaren Akzent: Es geht darum, Buffets malerische Position neun Jahre nach seinem Tod neu zur Diskussion zu stellen.
Und es geht um etwas, was das MMK als eine Ausstellungstrilogie apostrophiert: einen Zusammenhang dieser Präsentation mit der vorangegangenen der Werke von Hans Josephsohn und der noch laufenden mit den fotografischen Arbeiten von Miroslav Tichý. Der Bildhauer, der Fotokünstler und der Maler – unterschiedlicher können die Protagonisten dieser Trilogie nicht sein, auf den ersten Blick jedenfalls. Und doch verbindet sie etwas Bemerkenswertes: Es ist die Unbedingtheit des jeweiligen schöpferischen Willens dieser drei, die Besessenheit von der Richtigkeit des einmal beschrittenen eigenen Weges, die Kompromisslosigkeit, diesen künstlerischen Weg ohne Rücksicht auf Reaktion und Rezeption bis zum – durch Kankheit und Alter vorgegebenen – Ende weiterzugehen.
Erinnern wir uns: Über nahezu sechs Jahrzehnte hinweg formulierte der jetzt 88jährige Hans Josephsohn in seinem Schaffen unbeirrt seine Position, mit seinen Skulpturen Volumina zu gestalten, gerade in Beziehung zum umgebenden Raum, in materieller Bescheidenheit und jenseits, ja abseits eines sich oft in modischen wie kommerziellen Ausrichtungen überstürzenden Kunst- und Galeriebetriebs. Denken wir ebenso an die Beharrlichkeit, mit der der bald 82 Jahre alte Miroslav Tichý, ein Leben lang am Rande der Gesellschaft und des Existenzminimums angesiedelt, seiner fotografischen Obsession folgte. Und nun Bernard Buffet – er hätte diesen Sommer sein achtzigstes Lebensjahr vollendet -, im Gegensatz zu den Vorgenannten zwar von geradezu immensem Reichtum umgeben: Auch er aber beharrte, scheinbar trotzig-unberührt von der internationalen Kunstwelt, die ihn mit Acht und Bann belegte, auf seiner einmal ausgeprägten, unverkennbar allein ihm gehörigen malerischen Sprache, bis ihm Krankheit das Malen unmöglich machte und er sich in Konsequenz dessen am 4. Oktober 1999 in seinem Atelier das Leben nahm. Bemerkenswert, dass ihn allein die Unmöglichkeit des Weitermalens und nicht die Verdammnis durch die institutionelle Szene zu diesem Schritt bewog.
Buffet polarisiert Publikum und Kunstbetrieb. Das war nicht immer so. Buffet wurde in den 50er Jahren, noch bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hinein, insbesondere von der französischen Linken und der französischen wie europäischen, dem Existenzialismus verhafteten Intelligenz als nahezu prophetische Figur, als legitimer Nachfolger Pablo Picassos gefeiert. Dann kam der Umschwung. Er liess sich wohlfeil unter künstlerischen Aspekten begründen: Man kritisierte seinen über Jahrzehnte nur wenig variierenden Stil als trivial, „geronnen“, „gefroren“ und „kalt“, als konservativ und sogar reaktionär. Seine seriellen, Alltagsmotiven gewidmeten Produktionen kamen mehr und mehr als „Kitsch“ in Verruf. Aber mit ursächlich waren zweifellos auch andere Faktoren: So sein Reichtum – materieller Erfolg seiner noch aus heutiger Sicht unglaublichen Popularität – , den er gerne zur Schau stellte. Buffet kaufte Landsitze und Schlösser und liess sich vor diesen ebenso wie vor seinem Rolls Royce in selbstgefälligen Positionen fotografieren. Die intellektuelle Linke, die ihn zuvor zu ihrer Gallionsfigur erhoben hatte, verweigerte ihm nun die Gefolgschaft. Heftige Kritik erfuhr sein oft ins Unerträgliche ausuferndes Merchandising, das auch vor dem Banalsten nicht Halt machte. Ein übriges trug die in vielem euphemische Rezeption der US-amerikanischen Kunst in Frankreich, ebenso in Deutschland und im übrigen Europa bei. Wobei zu konstatieren ist, dass in diesem Zuge auch Paris – ob zu Recht oder Unrecht – seine weltweite Vormachtstellung in dieser Szene an New York verlor.
Aber auch die Ausstellung im MMK polarisiert – es war nicht anders zu erwarten. Seine „Gemeinde“ hatte Udo Kittelmann bereits lange im Vorfeld auf die zu erwartende Kritik vorbereitet, die jetzt aus Teilen von Presse und Szene auf die Werkschau herabregnet. Bemerkenswert sei, so Kittelmann, der dies sicher mit Beweisen belegen kann, dass viele der damaligen wie heutigen Kritiker Buffets auf Nachfrage einräumen müssten, die Werke lediglich von Reproduktionen her, also nicht aus unmittelbar eigener Anschauung zu „kennen“. Und Kittelmann weiter: Die Heftigkeit, mit der die institutionelle Kunstwelt Buffet ablehnte, lege es nahe, Buffet als einen Verdrängten und nicht als einen Vergessenen zu sehen.
Die jetzigen Reaktionen sind gespalten, nehmen wir per Exempel nur das Feuilleton der FAZ: Während Werner Spies das Unternehmen Buffet sozusagen in Grund und Boden rammt („In Frankfurt wird eine Leiche wiederbelebt“) und auch Michael Hierholzer sich bei aller verbalen Zurückhaltung von Buffet distanziert, bricht Rose-Maria Gropp eine Lanze für Kittelmann und das MMK: „Nichts Geringeres als die Entdeckung eines Malers ist zu vermelden“, schreibt sie. Und: „Dann kommen die Momente, wenn Kunstwerke glühen vor Intensität, wenn sie unzerstörbar sind, auch durch die böse Nachrede, wenn sie heraustreten aus dem Schatten, wie lange verschollene Gefährten – und brandneu wirken.“
Und der Kritiker Christian Huther beispielsweise bescheinigt dem MMK, ihm sei „mit der Ausstellung eine furiose Wiederentdeckung gelungen“.
Zur Diskussion Stellen, Polarisieren versteht Kittelmann als eine der wichtigsten Aufgaben eines Museums für zeitgenössische Kunst mit einem Anspruch, wie ihn das MMK an sich selbst stellt. Eine Aufgabe, wie sie beispielsweise dem renommierten Frankfurter Städel Museum nicht obliegt; schon gar nicht so mancher Ausstellungsinstitution mit dem Ziel, vorrangig das Bekannte, Anerkannte und Bewährte, das „Wahre, Schöne, Gute“ unter das willige Publikum zu bringen.
Bernard Buffet, im Sommer 1928 in Paris geboren, besuchte zunächst das Lycée Carnot und studierte später an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Kunstgeschichte. Schon bald zählte der die abstrakte Malerei ablehnende Künstler zur Szene der französischen Avantgarde. 1948 erhielt er den begehrten „Prix de la Critique“. Der französische Staat liess ihn hohe Auszeichnungen erfahren: Noch 1971, als die Kunstwelt ihn bereits verfemte, wurde Buffet mit dem Titel „Chevalier de la Légion d’Honneur“ geehrt, 1974 berief ihn die angesehene Académie des Beaux-Arts zu ihrem Mitglied.
Bernard Buffet war ein von der Malerei Besessener. Man schätzt die Zahl allein seiner Gemälde in Öl auf rund 8000. Schon früh fand er seinen unverwechselbaren persönlichen Stil: vor allem die alle dargestellten Motive umgebenden, mit Kohle vorgezeichneten harten Konturen. Im Vordergrund dominieren die Linien, der die farbige Ausfüllung der Flächen zu folgen hat. Bedrohlichkeit und Verunsicherung, Melancholie und Verzweiflung drücken diese Bilder aus – und sie entsprachen damit manchen Befindlichkeiten der Nachkriegszeit. Nahezu monochrom sind seine frühen Bilder, geprägt von dem unendlichen Leid, das der Krieg über die Menschen gebracht hatte, geprägt auch von der „Hungerleider“- Figurativität eines existenzialistischen „Miserabilismus“, die – ausgehend von frühen Selbstdarstellungen – Buffets Bildsprache bis zu seinem Tod bestimmte. In diesem einmal festgelegten Rahmen war ihm kein Sujet zu sakral oder zu banal, um es darin festzuhalten, seien es die Passion Christi, die Hundertschaften an Städte- und Tieransichten, die berühmt-berüchtigten Clowns oder die serienweise Abbildung von Automobilen.
Buffet arbeitete, besonders in seinen Werkzyklen, häufig mit Versatzstücken: den typisierten Gesichtern, Händen und Fingern, Füssen und Zehen, Totenschädeln, Pistolen und Revolvern. Man könnte sagen, er habe mit diesen stilistischen Mitteln die sich später massenhaft ausbreitende Comic- und Pop art- Kunst vorweggenommen. Immer wieder zitierte er in neuen Werken aus seinen vorherigen Bildern (das haben nun beispielsweise auch Pablo Picasso oder in der Musik Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart mit grösstem Erfolg bei bester Reputation getan).
Seine damalige umfassende Präsenz in der Alltagswelt kann man sich heute wohl nicht mehr vorstellen: Kaum ein Wartezimmer einer Arztpraxis, einer Anwaltskanzlei blieben von Reproduktionen Buffetscher Werke verschont. Sie füllten die Regale der billig hergestellte Dekorationskunst für ein breites Publikum feilbietenden Kaufhäuser, schmückten Arbeits- wie Toilettenräume zeitgeistig eingerichteter Studentenbuden. Ganz zu schweigen von einer Flut an Buch- und Schallplattenhüllen, Flaschenetiketten, Kaffeebechern und Teeservices, Halstüchern und Krawatten bis hin zu Turnschuhen. Dieser visuelle „overkill“ führte zu einer Übersättigung der Öffentlichkeit. Wobei man berücksichtigen muss, dass die massenhafte Reproduktion letztlich nur einer aus dem damaligen Zeitgeist getroffenen Auswahl an Motiven den Blick auf vieles andere des Buffetschen Oeuvres verstellte. So wurde Buffet ein Opfer der modernen massenmedialen Gesellschaft wie auch seiner von ihm selbst entfesselten Vermarktungsstrategie.
Rund sechzig Arbeiten Buffets zeigt das MMK in seiner derzeitigen Ausstellung aus den rund sechs Jahrzehnten seines Schaffens. Fast alle stammen sie aus dem von dem Pariser Galeristen Maurice Garnier betreuten Nachlass. Sie sind mitunter, etwa die Zyklen „L’horreur de la guerre“ von 1954, „Vingt mille lieues sous les mers“ von 1989 oder „La passion du Christ“, von nahezu monumentalen Abmessungen.
Ihm näher Stehende werten Buffets Werk mitunter als den Schlussstrich unter die klassische Moderne. Hat aber seine Malerei uns heute noch – oder vielleicht sogar wieder – etwas zu sagen, geht sie uns etwas an? Hilft sie uns gar dabei, uns in der gegenwärtigen Welt wieder einmal des Guten wie des Bösen, des Richtigen wie des Falschen zu vergewissern?
Was sagt uns sein grosser Bilderzyklus über den bekannten Roman von Jules Verne „Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer“? Etwas über unser Träumen von einer Reise um die Welt, aber auch die Unterwerfung dieser Welt, unsere damit verbundenen Macht- und Allmachtsfantasien?
Wie steht es mit dem Hunger, den Kriegen, den „ethnischen Säuberungen“, der Folter, den von Menschen entfachten Katastrophen, wie steht es mit Mordlust, Werteverfall, Gleichgültigkeit, Drogen- und Spielsucht im heutigen medialen Zeitalter? Was bedeuten uns – beispielsweise – die Nachrichten und Bilder aus Darfur, aus der Hölle des Irak-Krieges? Welche Botschaft geben uns – gleichsam vor unserer eigenen Haustür – überforderte, verwahrloste Eltern, wenn sie ihre leiblichen Kinder, wie wir den Medien fast im Wochenrhythmus entnehmen müssen, verhungern lassen oder töten? Was sagt uns der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, wenn er dokumentiert, dass in diesem „reichen“ Land ein Viertel der Bevölkerung an der Armutsgrenze beziehungsweise in Armut lebt?
Was bedeutet uns dies alles, wenn wir heute vor der Malerei Bernhard Buffets stehen? Wollen wir gar nicht erst hinschauen, oder wollen wir im Angesicht der Buffetschen Leichenfelder, der furchtbar Gehäuteten, der Skelette, der in witwenschwarz gekleideten, verhärmten Frauen, der Kreuzigungsszene schnell wieder wegschauen? Ist Buffet auf eine Weise, die uns unangenehm ist, aktuell? Wie verstehen wir uns zu den Schimpfworten wie „Hungerleidermalerei“ oder „Miserabilismus“? Und wollen wir stilistisch-ästhetischen, dem Kern nach akademischen Fragen Vorrang einräumen vor den inhaltlichen, relevanten?
„Reicht seine [Buffets] Kraft womöglich bis in unsere Zeitgenossenschaft?“ fragt Rose-Maria Gropp in der FAZ. Wir möchten uns dieser Frage anschliessen. Und dabei nach vorne schauen.